Abwarten und Tee trinken: So scheitert Europa an seiner eigenen Digitalmacht
Die EU hatte wichtige Regeln gegen die Macht der großen US-Tech-Konzerne auf den Weg gebracht. Nun zögert sie aus Angst vor Trumps Handelsstrategie.
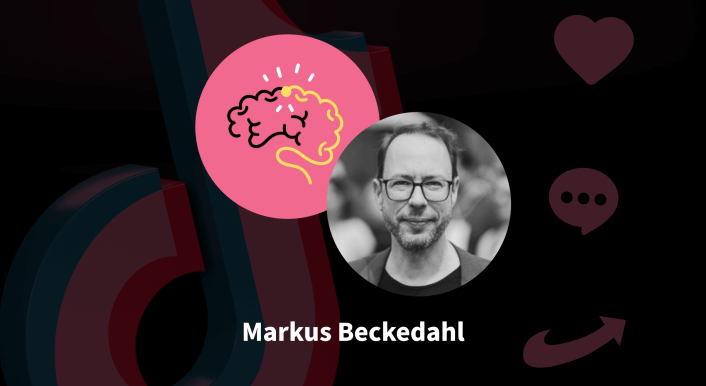
Markus Beckedahl ist Pionier für digitale Öffentlichkeit. Er hat das Magazin netzpolitik.org gegründet und ist kuratorischer Leiter der re:publica, der größten Konferenz für digitale Gesellschaft.
Es hätte alles so schön sein können. Ursula von der Leyen sprach als EU-Kommissionspräsidentin beim Beschluss des Digital Services Act (DSA) vom „Grundgesetz fürs Internet“. Das war zwar hoch gegriffen, aber die Hoffnung war da: Mit DSA und Digital Markets Act (DMA) hatte die EU wirksame Regeln zur Plattformregulierung geschaffen – und vielleicht auch den Mut, sie gegen die dominierenden Big-Tech-Unternehmen durchzusetzen. Zugegeben: Die Regeln kamen zu spät, um Monopole rechtzeitig zu verhindern. Aber immerhin rechtzeitig genug, um noch Wirkung entfalten zu können.
Die Macht der Tech-Oligarchen
Es war die Zeit, als Elon Musk Twitter übernahm und zu X umbaute. Plötzlich wurde deutlich, wie abhängig unsere digitalen Öffentlichkeiten von wenigen Privatakteuren sind – die über Nacht die Spielregeln ändern, wenn es ihren ideologischen oder wirtschaftlichen Interessen dient. Musk nutzte seine neue Macht, um rechtsradikale Akteure und Positionen zu verstärken. Ermittlungen der EU-Kommission folgten. Und dann kam Trump zurück ins Amt.
Seitdem ist es still geworden um die Plattformregulierung. Trump demonstrierte seine Macht, indem er bei seiner Amtseinführung die Tech-Oligarchen hinter sich aufreihte. Diese dankten es ihm mit Tributzahlungen und öffentlichen Unterwerfungsszenen – ein Signal, dass sie künftig gemeinsame Sache machen würden.
Stillhalten aus Angst vor Zöllen
Die Öffentlichkeit nahm die Macht dieser Oligarchen nun deutlicher wahr. Nur die Politik wurde leiser. Man versprach zwar immer wieder, die europäischen Regeln würden selbstverständlich durchgesetzt. Doch abseits der Rhetorik geschah wenig. Spätestens als Trump mit Zöllen drohte und damit die Autoindustrie ins Visier nahm, wurden Verfahren gegen US-Konzerne auf die lange Bank geschoben. Lebenszeichen der Regulierung gab es nur noch gegen Porno-Plattformen und TikTok.
Zur Begründung hieß es: Erst den Handelsdeal abwarten, die EU-Kommission müsse hier behutsam agieren. Doch genau hier zeigte sich eine Schwäche der Konstruktion von DSA und DMA: Statt einer unabhängigen Digitalagentur ist die EU-Kommission selbst für die Durchsetzung zuständig – und verhandelt zugleich unsere Handelsinteressen mit den USA. Was kann da schon schiefgehen?
In unserer neuen Kategorie Denkanstoß sammeln wir kluge Ideen, zu Themen, die wir als Gesellschaft bewältigen müssen. In loser Folge kuratieren wir hier Gast-Beiträge.
Plattformregeln nicht Teil des Handelsdeals
Im Sommer wurde der „Handelsdeal“ präsentiert. Digitalthemen spielten nur eine Nebenrolle. In einer gemeinsamen Erklärung verpflichteten sich EU und USA, „ungerechtfertigte digitale Handelshemmnisse zu beseitigen“. Die Kommission sagte dabei auch zu, keine Netznutzungsgebühren einzuführen – ein Schritt, der eigentlich noch im laufenden Gesetzgebungsprozess zum Digital Networks Act verhandelt wurde.
Diese „Zollgebühr fürs Internet“ ist seit Jahren ein Lobbyprojekt der Telekommunikationsbranche: Big Tech solle für den Breitbandausbau zahlen. Zivilgesellschaftliche Kritik war stets, dass damit ein Zwei-Klassen-Netz droht – in dem zahlende Akteure bevorzugt durchgeleitet werden, während alle anderen auf digitale Trampelpfade geschickt werden.
Auch Zölle auf elektronische Übertragungen wurden ausgeschlossen – sinnvoll für Verbraucher:innen, die weiterhin Windows-Lizenzen oder Filme online ohne Aufpreis kaufen können.
Die EU-Kommission betonte immer wieder, sie habe verhindert, dass unsere Plattformregeln Teil des Handelsdeals und somit verwässert wurden. Nun könne es endlich losgehen – oder?
Tauschgeschäft: Zurückhaltung gegen niedrige Zölle
Die Realität sieht anders aus. Im Kern steht ein Tauschgeschäft: niedrigere Autozölle gegen schwächere Regulierung. Kaum war der Deal veröffentlicht, drohte Trump offen. Auf Truth Social schrieb er: Staaten, die US-Unternehmen durch Regulierung oder Steuern schaden, müssten mit Strafzöllen und Exportbeschränkungen bei US-Chips rechnen. „Show respect to America and our amazing tech companies or consider the consequences!“
Und Europa? Friedrich Merz erklärte bei einem Treffen mit Emmanuel Macron zwar unmissverständlich: „Wir tun dies in unserem eigenen Interesse und ausschließlich in unserem eigenen Interesse, und wir werden uns sicherlich nicht von Aussagen leiten lassen, die vielleicht ganz andere, vielleicht sogar gar keine Regulierung für notwendig halten […] Wir werden es nicht akzeptieren, wenn irgendjemand irgendwo versucht, Druck auf uns auszuüben.“
Trumps Drohkulisse wirkt offenbar
Doch zeitgleich berichtete Reuters, dass das US-Außenministerium Sanktionen gegen jene prüfe, die für die Umsetzung von EU-Regeln verantwortlich sind – eine kaum verhüllte Drohung gegen europäische Regulierungsbehörden bis hin zur Kommission.
Diese Erinnerung an frühere Sanktionen Trumps – etwa gegen den Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs, die Microsoft sofort umsetzte, indem es dessen Zugang zu Mails und Infrastruktur sperrte – wirkte wie ein Weckruf: Mehr digitale Souveränität ist dringend nötig.
Schon lange vor dem DMA laufen die Ermittlungen, ob Googles Werbedominanz gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstößt. Der Fall gilt als Präzedenzfall mit enormen Auswirkungen auf Wettbewerb und Medienfinanzierung. Doch obwohl das Verfahren seit vier Jahren lief und laut Brüssel längst entscheidungsreif war, wurde es offenkundig seit Monaten zurückgehalten – aus Angst vor Trump, aus Hoffnung auf niedrigere Autozölle. Anfang September hat die EU-Kommission ihre Entscheidung verkündet.
Abwarten ist eine schwache Strategie
Die Möglichkeiten reichten von einer Zerschlagung über hohe oder symbolische Strafen bis hin zu einer bloßen Verwarnung – Google kommt nun mit einer Geldstrafe davon. Der Fall zeigt vor allem eins: Die Strategie heißt Abwarten. Bloß keine laufenden Handelsgespräche stören.
Das Problem: Es gibt nicht „den einen Handelsdeal“. Trump verfolgt ausschließlich eigene Interessen und macht klar, dass er frühere Vereinbarungen jederzeit kippen kann. Währenddessen wächst die Macht der US-Techkonzerne ungebremst.
Was dabei oft übersehen wird: Eine Strafe ist nur der Anfang. Danach folgen jahrelange Gerichtsverfahren – realistisch mindestens fünf Jahre von der Eröffnung bis zum endgültigen Urteil. In dieser Zeit können die Unternehmen ihre Marktstellung ausbauen, auch mit rechtswidrigen Praktiken. Strafzahlungen und Prozesskosten sind längst eingepreist – seit 20 Jahren fahren sie damit gut.
Handeln statt Worte nötig
Die Politik hingegen wiederholt altbekannte Floskeln: Natürlich müsse man unsere Werte verteidigen, digitale Souveränität sei unverzichtbar. Doch am Ende bleibt es oft bei Worten.
Deshalb müssen wir weiter Druck machen, damit die Politik endlich handelt. Die Regeln von DSA und DMA wurden aus guten Gründen geschaffen: um Wettbewerb, Meinungsfreiheit und Demokratie zu schützen. Jetzt müssen sie konsequent durchgesetzt werden.
Aktualisierung: In einer ersten Fassung war das Urteil gegen Google noch nicht gefällt, das ist im Text nun aufgenommen.

